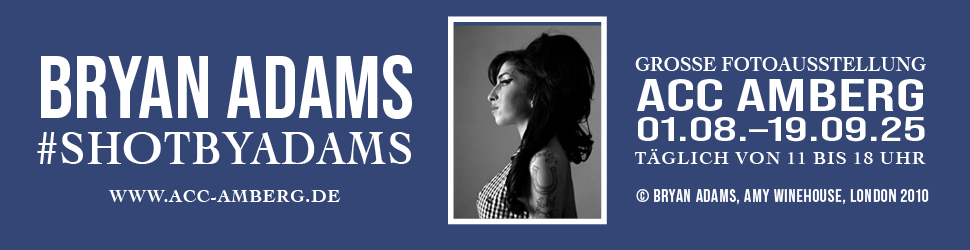
Das bunte Unbehagen unserer Gegenwart - Studierende der Staatlichen Akademie der Künste Karlsruhe präsentieren ihre Arbeiten
Eine rechteckige, hochkant bearbeitete Leinwand. Vom oberen Bildrand kommend legt sich eine weiße Farbschicht auf eine schon zur Hälfte verdeckte abstrakte Darstellung. Große blaue Buchstaben verhindern den Blick auf das darunter Liegende zusätzlich. Ihre Ordnung ist durcheinander geraten; nicht einmal die Sprache bietet noch die gewohnte Orientierung: DERUNT ERGANG DES GOLDENEN ZEI TALTERS steht da auf vier Zeilen verteilt.
Lil Grimms Arbeit Ohne Titel (2025, Acryl auf Leinwand) lässt sich als Kommentar auf unsere Gegenwart lesen: Das Goldene Zeitalter steht uns nicht etwa bevor - so wie es Donald Trump seinen (also ausschließlich seinen) Landsleuten verspricht. Das Goldene Zeitalter, im Sinne von Hesiod, das sorglose, friedliche Leben, oder vielmehr die Erzählung davon, ist passé.
Mit dieser Arbeit lässt sich auch ein Grundrauschen umschreiben, das die diesjährige Sommerausstellung der rund 320 Studierenden der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe bestimmt. Die Auseinandersetzung mit einer unsicheren, beängstigenden, kriegs- und krisengeprägten Gegenwart ist an vielen Stellen spürbar. Eine Reihe von Positionen artikulieren Kritik an unserer Gegenwart: Armin Ekics Arbeit Workingclass Hero thematisiert die Kinderarbeit und Armut, die große Schokoladenhersteller wie Ferrero trotz vorhandener Nachhaltigkeitsprogramme nach wie vor aufrechterhalten. Und Felix Wagners Arbeit SURVIVAL - eine mit Stacheldraht umwickelte Bank - erinnert an die sogenannte defensive Architektur, also beispielsweise an Bänke, die so gebaut sind, dass Menschen - insbesondere obdachlose Menschen - hier nicht liegen oder schlafen können. In Verbindung mit der dahinter gezeigten Videoinstallation BETON RAUM, die auf übereinander gestapelten Bildschirmen Aufnahmen von Gebäuden zeigt, drängt sich das Zitat Winston Churchills auf: „First we shape our buildings, then they shape us“. Wagners Arbeiten regen dazu an, über die von der Architekturpsychologie untersuchten Auswirkungen der von uns gebauten Umwelt auf unser Befinden und unser Verhalten nachzudenken.

Und auch Gaza ist präsent - nicht nur in Form von Flaggen, die sich am Eröffnungsabend einige Studierende gebunden haben, sondern auch in manchen Arbeiten, so in der Installation Salute to Gaza (2025) von Kai Salzer, Allmans, Rayen Breitenbücher und Carla Santin. Ihren Titel und Sound entnimmt die Installation einem 2016 erschienenen Album des Gaza Youth Choir, dessen Musiker:innen und Sänger:innen Studierende des Edward Said National Conservatory of Music waren oder sind. Es hat Standorte in Ramallah, Jerusalem, Bethlehem und Gaza. Während die Instrumente in einem Studio in Ramallah aufgenommen wurden, fanden die Aufnahmen des Chors und der Solo-Parts in Gaza statt. Es ist unklar, wie viele der Menschen, deren Stimmen wir hier hören, heute noch am Leben sind. Auf das unfassbare Ausmaß getöteter Kinder verweist in der Installation auch ein hinter einer der drei palästinensischen Flaggen angebrachter Text. Mit ihrer Arbeit Salute to Gaza erinnern die vier Künstler:innen an die reiche palästinensische Kultur und thematisieren die Unmenschlichkeit der Gegenwart, ganz ohne sich hierbei auf Bilder aus Gaza zu berufen, die sich uns ohnehin längst schon eingebrannt haben.
Auch der 1985 in Damaskus geborene Videokünstler Anas Kahal, der in diesem Jahr den mit 10.000 Euro dotierten Kalinowski-Preis erhielt, setzt sich in seiner künstlerischen Praxis mit den Themen Krieg, Flucht und Vertreibung auseinander. Für seine Sechskanal-Installation Masked Faces (2024) verwendete Kahal Ausschnitte aus YouTube-Videos von 2011, in denen maskierte Männer ihre radikalen Überzeugungen kundtun. Die Installation arbeitet das Spannungsverhältnis zwischen dem Individuum und der Gruppe heraus und nimmt die sich hier vollziehende Radikalisierung in den Fokus.
Neben dem Komplex kritischer, politischer Werke vermitteln andere Arbeiten ein weniger spezifisches Unbehagen; sie setzen unheilvolle Narrationen in Gang oder kommen wie Szenen aus Albträumen daher, so die mal in erdigen Farben gehaltenen, mal wie von einem grauen Schleier überdeckten Bilder von Aylin Altuner. Oder
die Skulptur Prinzesschen (2025) von Julia Frey, in der wir in einem Miniaturzimmer auf ein von großen Nägeln durchbohrtes Prinzessin-auf-der-Erbse-Bett blicken. Gelegentlich versteckt sich hinter einer fröhlich wirkenden Farbigkeit ein dunkles Moment, so wie bei Yvonne Duttlinger: Die vier eng nebeneinander gehängten kleinformatigen Malereien lassen erst auf den zweiten Blick vermuten, dass das drollige Häschen Teil eines drogeninduzierten Rauschs ist. Und die von expressiver Farbigkeit geprägte, sich der Comic-Ästhetik bedienende Bildsprache von Franky Brożek steht im starken Kontrast zu den unheilvollen Szenen: Alle Männer massenkastrieren! (2025) heißt es in einer in Ölkreide auf Pappe gefertigten Arbeit und direkt daneben zeigt seine Arbeit gespenst (2025) eine blutige Szene aus einem Gefangenenlager.

Bei anderen Werken lässt sich ein Austesten des Mediums Malerei beobachten (ohnehin ist Malerei das am stärksten vertretene Medium): Da ist die gefaltete, an der Wand angebrachte Leinwand (Materialangabe: gefundener Leinwandstoff) von Felix Jacob (leiwand, 2025) und Lina Kolbs abstrakte Landschaft niemand versteckt nichts, die sich erst aus der Nähe betrachtet als Malervlies zu erkennen gibt.
Starke Positionen offenbaren auch die flächigen Malereien von Changxiao Wang, dessen fantastische Arbeit Vor dem Fenster (2024) für das Plakat der Ausstellung übernommen wurde. Elias Nouira verdoppelt in seinem Gemälde o.T. den Ausstellungsraum und Lucia Mattes’ Wandarbeit Lady Oscar Pt. 2 gibt einen Einblick in ihre Praxis, in der die Künstlerin immer wieder mit Filz arbeitet und in der sie die Bilderwelt der Internet- und Jugendkultur aufnimmt.
Fotografie und Film tauchen eher vereinzelt auf, aber wenn, dann überzeugend. Hier sind neben Wagners bereits genannter Video-Installation BETON RAUM auf jeden Fall Emily Ebners Dokumentarfilm L’art de recevoir / Die Kunst des Aufnehmens (2025) zu nennen sowie Lilly-Marie Walters Fotografie Beito armuh bahro, die ganz wunderbar mit Licht spielt. Walter lässt aus einer alltäglichen Szene - ein junger Mensch liegt mit geschlossenen Augen in einem Raum neben einem Stuhl und einem Spiegel - eine malerische Szene werden, in der die unterschiedlichen Oberflächen der einzelnen Bildkomponenten zu einem interessanten Zusammenspiel führen.
Und die Textil-Arbeit Über das Weichsein von Marla Schäfer thematisiert den konfliktbehafteten gesellschaftlichen Blick auf den weiblichen Körper. Die Künstlerin stickte die Umrisse eines Frauenkörpers sowie einige Textpassagen auf ein Stück Leinenstoff: „Sie wollte immer früh Kinder, dann hätte sie eine Entschuldigung für ihren Körper.“ heißt es hier an einer Stelle und weiter unten, ganz klein: „Können wir im Dunkeln duschen?“.
Es sind auch die leiseren Arbeiten wie Beito armuh bahro oder Über das Weichsein, die sich in dieser Ausstellung Platz verschaffen und die zu einer hohen Qualität der Ausstellung beitragen.
Staatlichen Akademie der Künste Karlsruhe
Reinhold-Frank-Straße 67
76133 Karlsruhe
www.kunstakademie-karlsruhe.de
Ferial Nadja Karrasch
Anzeige
Kataloge/Medien zum Thema:
Kunsthochschule

Haus am Kleistpark

Galerie im Körnerpark
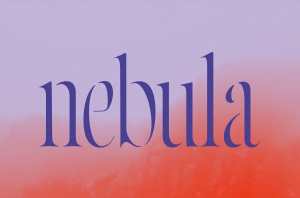
Galerie im Saalbau
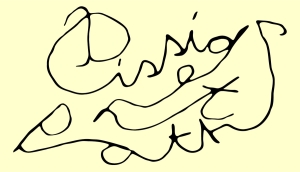
neue Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK)

Kommunale Galerie Berlin