Bernd und Hilla Becher, Gutehoffnungshütte, Oberhausen, D, 1963, Silbergelatine-Abzug, 50 x 60 cm, © Bernd und Hilla Becher / Courtesy of Schirmer/Mosel
Über vierzig Jahre lang hat das Fotografenpaar Bernd (1931-2007) und Hilla Becher (*1934) an einer Bestandsaufnahme von Gebäuden der Industriearchitektur gearbeitet. Fabrikhallen, Fördertürme, Gasbehälter, Stahlöfen, aber auch Fachwerkhäuser gehören zu den Sujets, die sie in Deutschland, in England, Frankreich, Mitteleuropa und den USA aufgenommen haben. Sie nennen diese Gebäude „Anonyme Skulpturen“. Damit wollen sie auf die künstlerische Qualität der Bauwerke hinweisen, die im Bewusstsein der zumeist unbekannten Baumeister und Benutzer keine Rolle spielte. Ihre Fotografie will diese verborgenen skulpturalen Qualitäten verdeutlichen und sie als untergehende Baukultur historisch dokumentieren.
Bernd und Hilla Becher haben sich immer mit besonderem Interesse der Industriearchitektur im Ruhrgebiet gewidmet. Zum ersten Mal wird mit der Ausstellung Bergwerke und Hütten – Industrielandschaften dieser Bereich ihres Schaffens systematisch erschlossen. Namen wie die der Zechen Concordia und Hannibal oder der Gutehoffnungshütte stehen bis heute für die industrielle Geschichte des Ruhrgebiets. Dabei konzentriert sich die Ausstellung nicht auf einzelne Gebäude. Bergwerke, die die Kohle für die Eisen- und Stahlgewinnung in den Hüttenanlagen förderten, werden vielmehr als ganze und ihre Situierung innerhalb des Kultur- oder Naturraums in den Blick genommen. Dieser von den Bechers „Industrielandschaft“ genannte Bildtypus stellt das Ruhrgebiet in Bezug zu vergleichbaren Komplexen in Europa und den USA.
Ähnlich wie in den typologischen Mehrfachansichten und Reihungen von Konstruktionen zielen Bernd und Hilla Becher auch in ihren Industrielandschaften auf ein vergleichendes Sehen. Mit grosser fotografischer Zurückhaltung in ihren Mitteln und im Sinn der „Neuen Sachlichkeit“ ganz dem Gegenstand verpflichtet, stehen sie in einer langen Tradition wichtiger Vertreter des dokumentarischen Blicks wie Eugène Atget, Karl Blossfeldt, Walker Evans, Albert Renger-Patzsch und August Sander. Dabei reicht ihr Einfluss auf die Geschichte der Fotografie mit der Etablierung der „Düsseldorfer Schule“ bis in die Gegenwart hinein. In einem Gespräch gaben Bernd und Hilla Becher 2005 zu Protokoll: „Das Hauptziel unserer Arbeit ist, zu beweisen, dass die Formen unserer Zeit die technischen Formen sind, obwohl sie nicht der Form willen entstanden sind. So wie sich das mittelalterliche Denken in der gotischen Kathedrale manifestiert, zeigt sich unser Zeitalter in den Gebäuden und Apparaturen der Technik.“
Mehr als die bekannten einfachen Gebäude-Typologien können diese Industrielandschaften unter zeithistorischen und sozialen Gesichtspunkten gelesen werden. Neben den monumentalen Funktionsbauten sind oft Wohnhäuser, Gärten und Kleingärten zu sehen, die zeigen, wie verschränkt Leben und Arbeiten zu dieser Zeit organisiert waren und wie tief verwurzelt der Mensch in diesen stadtähnlichen Gebilden war. Vom halbhohen Standpunkt aus aufgenommen, folgen die horizontal angelegten Fotografien mit ihrem weiten, öffnenden Blick zwar einer eigenen, für die Bechers fast untypischen Bildästhetik, ordnen sich aber in der Systematik in das archivarische Denken des Künstlerpaares ein.
Die von Heinz Liesbrock kuratierte Ausstellung wurde vom Josef Albers Museum Quadrat in Bottrop organisiert und dort 2010 gezeigt. Im Fotomuseum Winterthur wird die Ausstellung von Thomas Seelig kuratiert.
Öffnungszeiten zur aktuellen Ausstellung: Dienstag bis Sonntag 11-18 Uhr, Mittwoch 11-20 Uhr, Montag geschlossen
Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 + 45
CH-8400 Winterthur (Zürich)
Telefon +41 52 234 10 60
fotomuseum.ch
Medienmitteilung
Kataloge/Medien zum Thema:
Bernd und Hilla Becher

a.i.p. project - artists in progress

Galerie im Saalbau

Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin

Kommunale Galerie Berlin
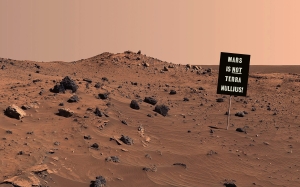
Kunstbrücke am Wildenbruch