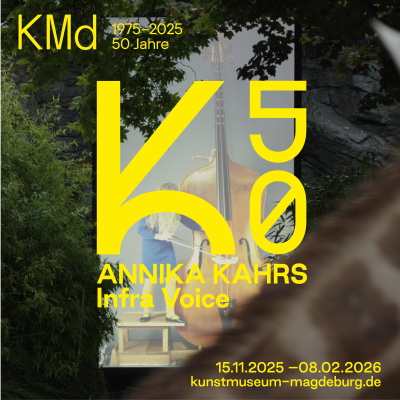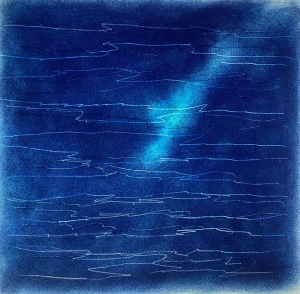Amelie von Wulffen
26.09.2025 - 14.12.2025 | Kölnischer Kunstverein, Köln
Eingabedatum: 26.09.2025

Vor zwei Jahren schrieb Amelie von Wulffen den Text „Des Pudels Kern”, in dem sie ihre neuesten Bilder in Bezug auf das bedrückende Zeitgeschehen sowie ihre „dysfunktionale Familiendynamik” unter die Lupe nahm.
Sie konstatierte ihre zunehmende Hinwendung zu einem Realismus und stellt die Frage, ob die Neue Sachlichkeit in den 1930er Jahren, also das Bedürfnis faktische Dinge wie ein Glas Wasser zu malen, von einer ähnlichen Verunsicherung durch Bedrohungen herrührte wie in der aktuellen Gegenwart. Noch steht alles scheinbar
intakt auf seinem Platz, aber etwas Unheimliches schwingt mit. Im Text ergründet von Wulffen einen Wesenskern vieler ihrer Bilder, der von einem komplexen Wechselspiel unterschiedlicher Wahrnehmungs- und Darstellungsebenen zeugt. Beobachtetes und Gedachtes überlagert sich mit Traum und Erinnerung und findet seinen Ausdruck in der wiederum eigenen Wirklichkeitskonstruktion der Malerei. Gleichzeitig lauert in den Spalten ihrer dichten und fragmentierten Erzählungen verdrängtes Wissen.
Das Weltgeschehen hat sich immer weiter in eine Spirale des Unheimlichen bewegt und so ist es nicht verwunderlich, wenn die neuen Werke im Kunstverein dem Realen noch gewagter auf den Pelz rücken und von Wulffen noch rückhaltloser arbeitet. Bei den im Kunstverein gezeigten Arbeiten verhandelt von Wulffen wieder vermehrt einen Realismus, bei dem die Dinge nicht einfach sind, wie sie scheinen. Von Wulffens Realismus saugt im Prozess der Formung die Gespenster mannigfaltiger Fiktionen in sich auf. Es ist ein Realismus, der das Reale als etwas immer schon Gebrochenes begreift – Eine Wahrheit, die ohne ihre fiktionalen Albträume nicht real wäre.
Die bisher ungezeigten Skulpturen sind aus Pappmaché modelliert, einer eher aus dem Schulunterricht vertrauten Technik, die aber auch eine lange Tradition in der Bildhauerei hat und der sich die Künstlerin seit ihrer Berliner Retrospektive (2020) verstärkt zuwendet. Die Formung dieser Skulpturen, die mit einem ikonischen Kot-Geist begann, verlangt von Wulffen einiges ab. Denn Pappmaché lässt sich nicht nach Belieben formen, es ist aufwändig herzustellen, wird in vielen Schichten aufgetragen, weicht leicht wieder auf. Der Widerstand des Materials wird in der Sperrigkeit der Figuren deutlich, der langatmige Handarbeits-Prozess ist ihnen eingeschrieben. Doch selbst die wurstförmige Rolle zeigt einen anthropomorphen, wenn auch von der Schwerkraft des Lebens überwältigten Anstrich. Mit Ausnahme des Selbstporträts, das sich auf dem Boden liegend krümmt, bleiben die Wesen gesichtslos. Ihre Haut dient als Träger für Malerei vergangener Jahrhunderte, auf deren Flächen schöne Orte vorgestellt werden. Handelt es sich um Fluchtfantasien in der Gestalt idealisierender Stillleben und Pastoralen? Genau genommen tritt hier eine Fortsetzung der Malerei mit anderen Mitteln auf den Plan. Die Leinwand, der geordnete Bildträger in der Fläche, zerquetscht zum deformierten Homunkulus. Malerei auf der Haut von beschädigten Wesen? Die illusionistische, vereinzelt impressionistische Malerei blendet die schwerfälligen Körper aus, Farbe schlägt Form, oder nicht? Eines der Grundthemen der Malerei wird hier auf die Spitze getrieben.
Die eingetrockneten Kreaturen wirken aber auch wie aus den Bildwelten der Leinwände entsprungen, was ihren unheimlichen Anschein verstärkt. Sie stehen und sitzen, liegen und kriechen, wie Albträume, die beim Waten durchs Wasser erstarrt sind. Ihre gebrechliche Körperlichkeit lässt sie gleichzeitig auch unheimlich wirklich erscheinen. Sie stehen verloren, wie belastete, sich abmühende Menschenkörper, die sich mit Fiktionen behelfen.
Auch die Landschaften auf den bemalten Vorhängen in dieser Ausstellung sind gebrochene Idyllen einer Vergangenheit. Es handelt sich um die Welten von Biene Maja, Heidi, Fix und Foxi und Vater und Sohn. Die bürgerliche Malereigeschichte tritt bei von Wulffen immer wieder in Nachbarschaft einer popkulturellen Direktheit. Im Fall der Vorhangbilder sind es die Welten von Comics und Trickfilm. Im Unterschied zur Schwere der Skulpturen scheint hier alles leuchtend und leicht, flach und bunt. In der Kindheit verhießen die anrührenden Wesen das ganze Glück. Was wehmütige Gefühle an die Kindheit in der BRD wecken mag, gründet auf düsteren Schatten der deutschen Geschichte. Mit der Übertragung dieser Schatten der Schuld und den Abgründen, die sie auftun, sobald man näher schaut, beschäftigt sich von Wulffen seit vielen Jahren in zahlreichen ihrer Bilder.
Fix und Foxi, die beiden Fuchsbrüder, sind eine Erfindung des deutschen Walt Disneys, Rolf Kauka (1917–2000). Er entwarf sie in den 1950er Jahren in Anlehnung an die deutsche Sagenfigur Reineke Fuchs. Was den meisten wohl unbekannt sein dürfte, ist, dass Kauka, ein überzeugter Nazi, für Zeitungen der NSDAP arbeitete, weshalb er nach dem Krieg als politisch Belasteter nicht unter seinem eigenen Namen publizieren konnte und der Name seiner Frau Erika Kauka auf den Heften stand. Wie viele Nazis bewegte er sich in der Nachkriegs-BRD wie ein Fisch im Wasser. Auch der Erfinder der Biene Maja, Waldemar Bonsels (1880–1952), war ein bekennender Antisemit und strammer Nazi. In seinem Buch „Biene Maja” (1912) kämpft das Bienenvolk gegen die verschlagenen Hornissen und verteidigt ihr Reich, eine biologistische Sprache ganz im Sinne eines faschistischen Sozialdarwinismus. Vater und Sohn (erstmals 1934 erschienen) hingegen waren die textlosen Figuren des Zeichners e.o. plauen (1903–1944), deren harmlose Alltagserlebnisse von einem liebevollen Umgang miteinander geprägt sind. Hinter dem Pseudonym plauen verbarg sich Erich Ohser, der den Mut hatte, sich gegen das Regime zu stellen, er karikierte Hitler und Goebbels, worauf er mit dem Berufsverbot belegt und später aufgrund der Denunziation durch einen Nachbarn verhaftet wurde. Ohser erhängte sich in der Nacht vor der Verhandlung durch den Volksgerichtshof in seiner Gefängniszelle. Heidis Hintergrund wiederum ist unbefleckt, aber nicht minder von simplifizierenden Ideologien geprägt. Das von der Schweizer Autorin Johanna Spyri (1827–1901) geschriebene zweibändige Werk (1880/1881) spielt in einer heilen Alpenwelt, wo das Waisenkind zur Heimat findet und die „gesunde” Welt gar die kranke Freundin aus Frankfurt aus dem Rollstuhl befreit. Heidi wurde Mitte der 1970er Jahre in Japan als erstes Anime in deutscher Sprache produziert. Heute spielen Kinder in der Statistik der Konsumierenden eine nachgeordnete Rolle, denn die expandierende Anime-Industrie trifft weltweit immer mehr auf das Bedürfnis Erwachsener nach eindeutigen Werten, aber auch nach dem Sentimentalen vieler Anime-Geschichten. Einfache Botschaften geben Orientierung in einer instabilen Welt.
Wie diese Fluchten von einer ungleich vertrackten, nicht den eigenen Wünschen entsprechenden Wirklichkeit eingeholt werden, verdeutlichen in der Ausstellung die vielschichtigen, oft beklemmenden Bildwelten auf Leinwand. Viele der Szenarien finden vor dem Hintergrund einer rustikal-bürgerlichen Umgebung einer vergangenen Zeit statt. In den Interieurs vertiefen sich die Figuren in die Lektüre von Magazinen und Büchern; die Kacheln von Netflix führen das Geschehen in die Gegenwart, heute und damals treffen aufeinander, verschwimmen. Von Wulffen gelingt es in den Malereien nicht zuletzt, die eigenen autobiografischen Erkundungen mit den abgründigen Aspekten von Familiendynamiken, die viele erleben, zu überlagern. In den Bildern werden Erwachsene und Kinder von Gespenstern und Monstren verfolgt, die Familie ist eines davon. Auch Heidi hat Angst.
...
Parallel wird die Ausstellung "Jonas Lipps" gezeigt.
Das Weltgeschehen hat sich immer weiter in eine Spirale des Unheimlichen bewegt und so ist es nicht verwunderlich, wenn die neuen Werke im Kunstverein dem Realen noch gewagter auf den Pelz rücken und von Wulffen noch rückhaltloser arbeitet. Bei den im Kunstverein gezeigten Arbeiten verhandelt von Wulffen wieder vermehrt einen Realismus, bei dem die Dinge nicht einfach sind, wie sie scheinen. Von Wulffens Realismus saugt im Prozess der Formung die Gespenster mannigfaltiger Fiktionen in sich auf. Es ist ein Realismus, der das Reale als etwas immer schon Gebrochenes begreift – Eine Wahrheit, die ohne ihre fiktionalen Albträume nicht real wäre.
Die bisher ungezeigten Skulpturen sind aus Pappmaché modelliert, einer eher aus dem Schulunterricht vertrauten Technik, die aber auch eine lange Tradition in der Bildhauerei hat und der sich die Künstlerin seit ihrer Berliner Retrospektive (2020) verstärkt zuwendet. Die Formung dieser Skulpturen, die mit einem ikonischen Kot-Geist begann, verlangt von Wulffen einiges ab. Denn Pappmaché lässt sich nicht nach Belieben formen, es ist aufwändig herzustellen, wird in vielen Schichten aufgetragen, weicht leicht wieder auf. Der Widerstand des Materials wird in der Sperrigkeit der Figuren deutlich, der langatmige Handarbeits-Prozess ist ihnen eingeschrieben. Doch selbst die wurstförmige Rolle zeigt einen anthropomorphen, wenn auch von der Schwerkraft des Lebens überwältigten Anstrich. Mit Ausnahme des Selbstporträts, das sich auf dem Boden liegend krümmt, bleiben die Wesen gesichtslos. Ihre Haut dient als Träger für Malerei vergangener Jahrhunderte, auf deren Flächen schöne Orte vorgestellt werden. Handelt es sich um Fluchtfantasien in der Gestalt idealisierender Stillleben und Pastoralen? Genau genommen tritt hier eine Fortsetzung der Malerei mit anderen Mitteln auf den Plan. Die Leinwand, der geordnete Bildträger in der Fläche, zerquetscht zum deformierten Homunkulus. Malerei auf der Haut von beschädigten Wesen? Die illusionistische, vereinzelt impressionistische Malerei blendet die schwerfälligen Körper aus, Farbe schlägt Form, oder nicht? Eines der Grundthemen der Malerei wird hier auf die Spitze getrieben.
Die eingetrockneten Kreaturen wirken aber auch wie aus den Bildwelten der Leinwände entsprungen, was ihren unheimlichen Anschein verstärkt. Sie stehen und sitzen, liegen und kriechen, wie Albträume, die beim Waten durchs Wasser erstarrt sind. Ihre gebrechliche Körperlichkeit lässt sie gleichzeitig auch unheimlich wirklich erscheinen. Sie stehen verloren, wie belastete, sich abmühende Menschenkörper, die sich mit Fiktionen behelfen.
Auch die Landschaften auf den bemalten Vorhängen in dieser Ausstellung sind gebrochene Idyllen einer Vergangenheit. Es handelt sich um die Welten von Biene Maja, Heidi, Fix und Foxi und Vater und Sohn. Die bürgerliche Malereigeschichte tritt bei von Wulffen immer wieder in Nachbarschaft einer popkulturellen Direktheit. Im Fall der Vorhangbilder sind es die Welten von Comics und Trickfilm. Im Unterschied zur Schwere der Skulpturen scheint hier alles leuchtend und leicht, flach und bunt. In der Kindheit verhießen die anrührenden Wesen das ganze Glück. Was wehmütige Gefühle an die Kindheit in der BRD wecken mag, gründet auf düsteren Schatten der deutschen Geschichte. Mit der Übertragung dieser Schatten der Schuld und den Abgründen, die sie auftun, sobald man näher schaut, beschäftigt sich von Wulffen seit vielen Jahren in zahlreichen ihrer Bilder.
Fix und Foxi, die beiden Fuchsbrüder, sind eine Erfindung des deutschen Walt Disneys, Rolf Kauka (1917–2000). Er entwarf sie in den 1950er Jahren in Anlehnung an die deutsche Sagenfigur Reineke Fuchs. Was den meisten wohl unbekannt sein dürfte, ist, dass Kauka, ein überzeugter Nazi, für Zeitungen der NSDAP arbeitete, weshalb er nach dem Krieg als politisch Belasteter nicht unter seinem eigenen Namen publizieren konnte und der Name seiner Frau Erika Kauka auf den Heften stand. Wie viele Nazis bewegte er sich in der Nachkriegs-BRD wie ein Fisch im Wasser. Auch der Erfinder der Biene Maja, Waldemar Bonsels (1880–1952), war ein bekennender Antisemit und strammer Nazi. In seinem Buch „Biene Maja” (1912) kämpft das Bienenvolk gegen die verschlagenen Hornissen und verteidigt ihr Reich, eine biologistische Sprache ganz im Sinne eines faschistischen Sozialdarwinismus. Vater und Sohn (erstmals 1934 erschienen) hingegen waren die textlosen Figuren des Zeichners e.o. plauen (1903–1944), deren harmlose Alltagserlebnisse von einem liebevollen Umgang miteinander geprägt sind. Hinter dem Pseudonym plauen verbarg sich Erich Ohser, der den Mut hatte, sich gegen das Regime zu stellen, er karikierte Hitler und Goebbels, worauf er mit dem Berufsverbot belegt und später aufgrund der Denunziation durch einen Nachbarn verhaftet wurde. Ohser erhängte sich in der Nacht vor der Verhandlung durch den Volksgerichtshof in seiner Gefängniszelle. Heidis Hintergrund wiederum ist unbefleckt, aber nicht minder von simplifizierenden Ideologien geprägt. Das von der Schweizer Autorin Johanna Spyri (1827–1901) geschriebene zweibändige Werk (1880/1881) spielt in einer heilen Alpenwelt, wo das Waisenkind zur Heimat findet und die „gesunde” Welt gar die kranke Freundin aus Frankfurt aus dem Rollstuhl befreit. Heidi wurde Mitte der 1970er Jahre in Japan als erstes Anime in deutscher Sprache produziert. Heute spielen Kinder in der Statistik der Konsumierenden eine nachgeordnete Rolle, denn die expandierende Anime-Industrie trifft weltweit immer mehr auf das Bedürfnis Erwachsener nach eindeutigen Werten, aber auch nach dem Sentimentalen vieler Anime-Geschichten. Einfache Botschaften geben Orientierung in einer instabilen Welt.
Wie diese Fluchten von einer ungleich vertrackten, nicht den eigenen Wünschen entsprechenden Wirklichkeit eingeholt werden, verdeutlichen in der Ausstellung die vielschichtigen, oft beklemmenden Bildwelten auf Leinwand. Viele der Szenarien finden vor dem Hintergrund einer rustikal-bürgerlichen Umgebung einer vergangenen Zeit statt. In den Interieurs vertiefen sich die Figuren in die Lektüre von Magazinen und Büchern; die Kacheln von Netflix führen das Geschehen in die Gegenwart, heute und damals treffen aufeinander, verschwimmen. Von Wulffen gelingt es in den Malereien nicht zuletzt, die eigenen autobiografischen Erkundungen mit den abgründigen Aspekten von Familiendynamiken, die viele erleben, zu überlagern. In den Bildern werden Erwachsene und Kinder von Gespenstern und Monstren verfolgt, die Familie ist eines davon. Auch Heidi hat Angst.
...
Parallel wird die Ausstellung "Jonas Lipps" gezeigt.
26.09.2025 - 14.12.2025
Kölnischer Kunstverein
Hahnenstraße 6, 50667 Köln
Presse
Kontext
Einordnung:Amelie von Wulffens Werk lässt sich im Kontext einer zeitgenössischen Auseinandersetzung mit Realismus verorten, die – ähnlich der Neuen Sachlichkeit – auf gesellschaftliche Verunsicherung reagiert. Im Gegensatz zu einer rein mimetischen Abbildung integriert von Wulffen Traum, Erinnerung und Fiktion, wodurch eine komplexe, vielschichtige Bildsprache entsteht. Ihre Pappmaché-Skulpturen, eine bewusste Anknüpfung an kunsthandwerkliche Traditionen, brechen die glatte Oberfläche des Realen durch ihre sperrige Materialität und die Integration von gemalten Idyllen – eine Dekonstruktion idealisierter Bildwelten vergangener Epochen. Die Verwendung popkultureller Motive wie Biene Maja oder Fix und Foxi, verbunden mit deren belasteter Entstehungsgeschichte, erweitert die Reflexion um die Verstrickung von scheinbar harmlosen Narrativen mit düsteren historischen Schatten. Von Wulffens Malerei überlagert autobiografische Elemente mit universellen Ängsten und thematisiert dysfunktionale Familienstrukturen. Ihre Praxis oszilliert zwischen verschiedenen Medien – Malerei, Skulptur, Zeichnung – und verbindet hohe und niedrige Kultur, um die Brüchigkeit der Gegenwart zu erfassen.